Du siehst gerade einen Platzhalter für Podigee. Um den Inhalt zu laden, klicke unten – dabei können Daten an Drittanbieter übermittelt werden.
Mehr InformationenIm Netz kursieren immer wieder Gerüchte, dass Esspausen – zum Beispiel beim Intervallfasten – schädlich für die Schilddrüse seien, vor allem bei einer Unterfunktion oder Hashimoto. Deshalb möchte ich in diesem Beitrag mal sehr genau auf dieses Thema eingehen.
Wir schauen uns an, warum moderate Esspausen deinem Stoffwechsel sogar helfen können, wie sie sich auf die Schilddrüsenhormone auswirken – und worauf du achten solltest, wenn du Hashimoto hast. Wissenschaftliche Studien zu diesem Thema findest du wie immer im Beitrag zu dieser Episode.
Was sind Esspausen?
Wenn ich in diesem Beitrag von moderaten Esspausen spreche, meine ich natürliche, alltagstaugliche Pausen – zum Beispiel 12 bis 14 Stunden über Nacht. Du isst also zum Beispiel das letzte Mal gegen 19:00 Uhr und nimmst dein Frühstück erst wieder zwischen 7.00 und 9.00 Uhr morgens zu dir. Und auch Esspausen zwischen den Mahlzeiten, also der Verzicht aufs ständige Snacken.
Über den Tag verteilt nimmst du ausreichend Energie und Nährstoffe auf – möglichst ohne zwischen den Hauptmahlzeiten zu snacken. So kann sich dein Blutzucker stabilisieren, dein Insulinspiegel beruhigen, und dein Körper lernt, seine Hunger- und Sättigungssignale zu hören [1].
Warum Esspausen guttun
Wenn du deinem Körper Pausen zwischen den Mahlzeiten gönnst, lernt er, ein kleines Hungergefühl nicht mehr reflexhaft mit einer existenziellen Mangelsituation gleichzusetzen. Ein Beispiel: Du bekommst um 11:00 Uhr Appetit, obwohl du erst um 8 Uhr gefrühstückt hast. Statt sofort zu essen, trinkst du ein Glas Wasser oder machst einen kleinen Spaziergang. Probiere das unbedingt mal aus! Nach 10 Minuten ist das Hungergefühl verschwunden – dein Körper hat gelernt, auf gespeicherte Energie zurückzugreifen, ohne gleich in Stress zu geraten [1].
Flexibler Stoffwechsel als Ziel
Genau das bezeichnet man als flexiblen Stoffwechsel: Dein Körper kann je nach Bedarf zwischen Zucker (Glukose) aus der Nahrung und Fett, z.B. aus den Reserven auf deinen Hüften, als Energiequelle hin- und herschalten. Diese Stoffwechsel-Flexibilität ist ein wichtiges Kennzeichen für einen gesunden, anpassungsfähigen Organismus – denn sie schützt dich vor Energieeinbrüchen, hält deinen Blutzucker stabil und ermöglicht, dass dein Körper Esspausen problemlos überbrückt [1].
Ein flexibler Stoffwechsel hilft dir außerdem dabei, mit körperlicher oder mentaler Belastung besser umzugehen, macht dich weniger anfällig für Heißhunger und stabilisiert deine Stimmung. Auch hormonelle Schwankungen – wie in den Wechseljahren – können besser abgepuffert werden, weil dein Körper nicht ständig im Überlebensmodus arbeiten muss, sondern gelassen zwischen seinen Energiequellen wechseln kann.
Das ist übrigens ein sehr natürlicher, evolutionär bewährter Mechanismus: In Zeiten, in denen Nahrung nicht rund um die Uhr verfügbar war, musste der Körper auch flexibel zwischen Nahrungsenergie und Energie aus körpereigenen Speichern wechseln können. Diese Flexibilität hat dein Körper immer noch – sie muss nur wieder aktiviert werden.
Die hormonellen Mechanismen hinter Esspausen
Ghrelin und Leptin: Hunger- und Sättigungssignale
Deine Hunger- und Sättigungshormone spielen hier eine zentrale Rolle: Das Hormon Ghrelin signalisiert deinem Körper, wann es Zeit ist zu essen, während Leptin die Botschaft übermittelt, dass du satt bist.
Durch ständiges Snacken zwischen den Mahlzeiten gerät die Regulation dieser Hormone aus dem Gleichgewicht: Ghrelin, das in der Magenwand gebildet wird und Hunger signalisiert, kann durch eine ständige Nahrungszufuhr, die vor allem durch das Snacken entsteht, dauerhaft unterdrückt oder unregelmäßig ausgeschüttet werden. Gleichzeitig führt häufiges Essen zu einer ständigen Leptin-Ausschüttung – was langfristig eine Leptinresistenz begünstigen kann, das bedeutet, die Botschaft “Ich bin satt” kommt nicht mehr in deinem Gehirn an.
Dies entsteht natürlich nicht alles über Nacht, sondern entwickelt sich schleichend über Monate hinweg, wenn dauerhaft hohe Leptinwerte auf chronisch volle Fettspeicher treffen und das Gehirn zunehmend weniger sensibel auf das Sättigungssignal reagiert.
Viele Mahlzeiten irritieren die Schilddrüse
Auch die Schilddrüse besitzt Leptinrezeptoren. Leptin wirkt dort als Signalgeber, der dem Hypothalamus vermittelt, ob ausreichend Energie vorhanden ist. Werden die Leptinrezeptoren über längere Zeit durch chronisch hohe Leptinspiegel überreizt, kann auch hier eine Leptinresistenz entstehen.
Der Hypothalamus – der Chef aller Hormone im Gehirn – reduziert dann die Freisetzung von TRH (Thyreotropin Releasing Hormone). Dieses Hormon übermittelt dem Körper normalerweise die Botschaft: „Bitte aktiviere die Energieministerin, die Schilddrüse!“ Weil der Hypothalamus durch die dauerhaft hohen Leptinspiegel fälschlicherweise glaubt, es sei genügend Energie vorhanden, fährt er diesen Startschuss deines Körpers, Energie bereitzustellen und damit auch den Stoffwechsel anzukurbeln, herunter. Ein Mechanismus aus uralter Zeit, um Energie zu sparen.
Die Hormonbalance wird gestört
Das wiederum führt dazu, dass die Hypophyse – die Sekretärin des Hypothalamus – weniger TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) ausschüttet. Dieses Hormon übermittelt der Schilddrüse die Botschaft: „Bitte produziere Schilddrüsenhormone!“ Die Schilddrüse reagiert darauf, indem sie weniger T4 bildet – ein Hormon, das deinem Körper signalisiert: „Sorge für Energie – der Stoffwechsel muss aktiv bleiben!“ In der Folge sinkt auch die Umwandlung in das stoffwechselaktive T3 – das deinem Körper die Botschaft vermittelt: „Stoffwechselaktivität bitte aufrechterhalten.“
Ein ausgewogener, nicht chronisch erhöhter Leptinspiegel ist also nicht nur für dein Sättigungsgefühl entscheidend, sondern wirkt auch als übergeordnetes Stoffwechselsignal, das eng mit der Funktion deiner Schilddrüse verknüpft ist. Wird dieses System gestört, kann das eine Kaskade hormoneller Dysbalancen auslösen – mit Folgen für deinen Energieverbrauch (der sinkt) und deine Fähigkeit, Körperfett zu mobilisieren (der Körper lagert eher Fett ein, statt es zu verbrennen). (6)
Hormonbalance durch Esspausen
Esspausen helfen, die Ausschüttung dieser Hormone wieder zu normalisieren – dein Hungergefühl wird differenzierter wahrnehmbar, dein Sättigungsempfinden verlässlicher. Wird dieses System dauerhaft gestört, verlierst du das Gefühl für echten Hunger – und isst möglicherweise, obwohl deine Energiespeicher längst gefüllt sind.
Cortisol: kurz hilfreich, chronisch belastend
Moderate Esspausen führen zu einem moderaten, physiologisch sinnvollen Cortisolanstieg – dieser unterstützt die Glukosemobilisierung und hält dich leistungsfähig. (8) Mit einem kleinen Hungergefühl kann unser Körper aber sehr gut umgehen. Wir mussten über viele Millionen Jahre sehr viel öfter und auch länger mit einem Hungeprgefühl klarkommen. Unser Körper kann das also sehr gut. Ein wenig Hunger ist ein alter Freund unseres Körpers.
Während ein kurzfristiger Cortisolanstieg, also akuter Stress, in Esspausen deine Schilddrüsenfunktion unterstützt, führt chronischer Stress zu einer chronischen Cortisolausschüttung und so auch wieder zu einer Hemmung der T4→T3-Umwandlung und verlangsamt deinen Stoffwechsel. Deshalb ist die Säule Achtsamkeit in meinem Coaching so wichtig – undn es ist gar nicht so schwer, das Leben im Hamsterrad mit kleinen Pausen zu unterbrechen und damit chronische Stressschleifen. pp
Studien belegen, dass Esspausen bei ausreichender Kalorienversorgung den T3-Spiegel stabil hält und nicht zum Anstieg des stoffwechselbremsenden rT3 wie bei Crashdiäten führt [2][3].
Besonderheiten bei Hashimoto
Vielleicht hast du schon gelesen, dass Esspausen bei Hashimoto-Thyreoiditis problematisch sein können. Tatsächlich bezieht sich diese Warnung häufig auf extreme Formen wie sehr langes Fasten ohne Kalorienzufuhr – also genau jene Belastungen, die den Stoffwechsel überfordern und Stressachsen aktivieren. In dieser Episode ging es aber nicht um extremes Fasten, sondern um moderate Esspausen, bei denen du deinem Körper zwischen den Mahlzeiten einfach mehr Ruhe gönnst.
Gerade bei Hashimoto ist es wichtig, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Insulin- und Leptin-Sensitivität zu verbessern – und genau hier setzen moderate Esspausen an.
Studien zeigen, dass zeitlich begrenzte Essensfenster mit ausreichender Kalorienzufuhr keinen negativen Einfluss auf die Schilddrüsenhormone haben – solange du regelmäßig isst, appusreichend Eiweiß, gesunde Fette und Mikronährstoffe aufnimmst und deinen Körper nicht in ein Energiedefizit zwingst. Vielmehr können moderate Pausen sogar dabei helfen, den Stoffwechsel zu entlasten und die Umwandlung von T4 in das aktive T3 zu fördern [4][5].
Wenn du Hashimoto hast und unsicher bist, beginne sanft – zum Beispiel mit 12 Stunden Essenspause über Nacht – und beobachte, wie dein Körper reagiert. Mit der richtigen Begleitung und einem ausgewogenen Essverhalten sind moderate Esspausen auch mit Hashimoto gut vereinbar – und können sogar hilfreich sein.
FAZIT
Esspausen fördern einen flexiblen, gesunden Stoffwechsel – auch und gerade in Bezug auf die Schilddrüse. Solange du ausreichend Kalorien und Nährstoffe aufnimmst, bleibt die Hormonproduktion stabil. Diese positiven Effekte gelten für moderate Esspausen mit durchdachter, nährstoffreicher Ernährung – nicht für Crash-Diäten oder extremes Fasten.
QUELLEN
- Mattson, M. P., Longo, V. D., & Harvie, M. (2017). Impact of intermittent fasting on health and disease processes. Physiology, 32(3), 230–240. https://doi.org/10.1152/physiol.00018.2016 – Überblick über die physiologischen Effekte von Intervallfasten, u. a. auf Stoffwechsel, Hormone, Entzündungsprozesse und Krankheitsrisiken.
- Capozzi, M. E., DiMarchi, R. D., & Tschöp, M. H. (2024). The metabolic effects of intermittent fasting in humans: Evidence and controversies. Frontiers in Endocrinology, 15, Article 11381305. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11381305 – Fasst aktuelle Studien zur Wirkung von Intervallfasten auf den menschlichen Stoffwechsel zusammen, inkl. möglicher hormoneller Anpassungen.
- Ebrahimi, M., Gholami, A., & Hemati, Z. (2023). The effect of intermittent fasting on thyroid hormones in healthy adults: A systematic review. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(2), e17716. https://brieflands.com/articles/ijem-17716 – Systematische Übersichtsarbeit zu den Auswirkungen intermittierenden Fastens auf Schilddrüsenhormone bei gesunden Erwachsenen.
- Root Functional Medicine. (n.d.). Intermittent fasting and hypothyroidism. Abgerufen am 27. Juli 2025, von https://rootfunctionalmedicine.com/intermittent-fasting-and-hypothyroid – Fachbeitrag über den Einfluss von moderatem Fasten bei Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion (inkl. Hashimoto), mit Praxistipps.
- Martens, C. R., Rossman, M. J., & Seals, D. R. (2021). Intermittent fasting: Physiological implications for human health. Journal of Endocrinological Investigation, 44, 1233–1245. https://doi.org/10.1007/s40618-021-01578-5 – Überblick über physiologische Wirkungen von Intervallfasten, einschließlich Effekten auf Hormonregulation und metabolische Gesundheit.
- Liu, X., Sun, X., Wang, Y., & Zhang, Y. (2025). Circulating leptin levels in thyroid dysfunction: a systematic review and meta-analysis. BMC Endocrine Disorders, 25(1), Article 88 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12142830/
- Hidaka, J. T., & Kaplan, M. M. (1988). Effects of insulin on iodothyronine 5′-deiodinase activity in human placental microsomes. Metabolism, 37(7), 664–668. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2838733/
- Kirschbaum, C., Wolf, O. T., May, M., Wippich, W., & Hellhammer, D. H. (1996). Stress- and treatment-induced elevations of cortisol levels associated with impaired declarative memory in healthy adults. Life Sciences, 58(17), 1475–1483. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9100580/
Podcast-Folge anhören
Du siehst gerade einen Platzhalter für Podigee. Um den Inhalt zu laden, klicke unten – dabei können Daten an Drittanbieter übermittelt werden.
Mehr Informationen#onceaweek-Podcast auf Spotify
#oneceaweek-Podcast auf Apple Podcast
#onceaweek-Podcast auf Podimo
#oneceaweel-Podcast auf Deezer


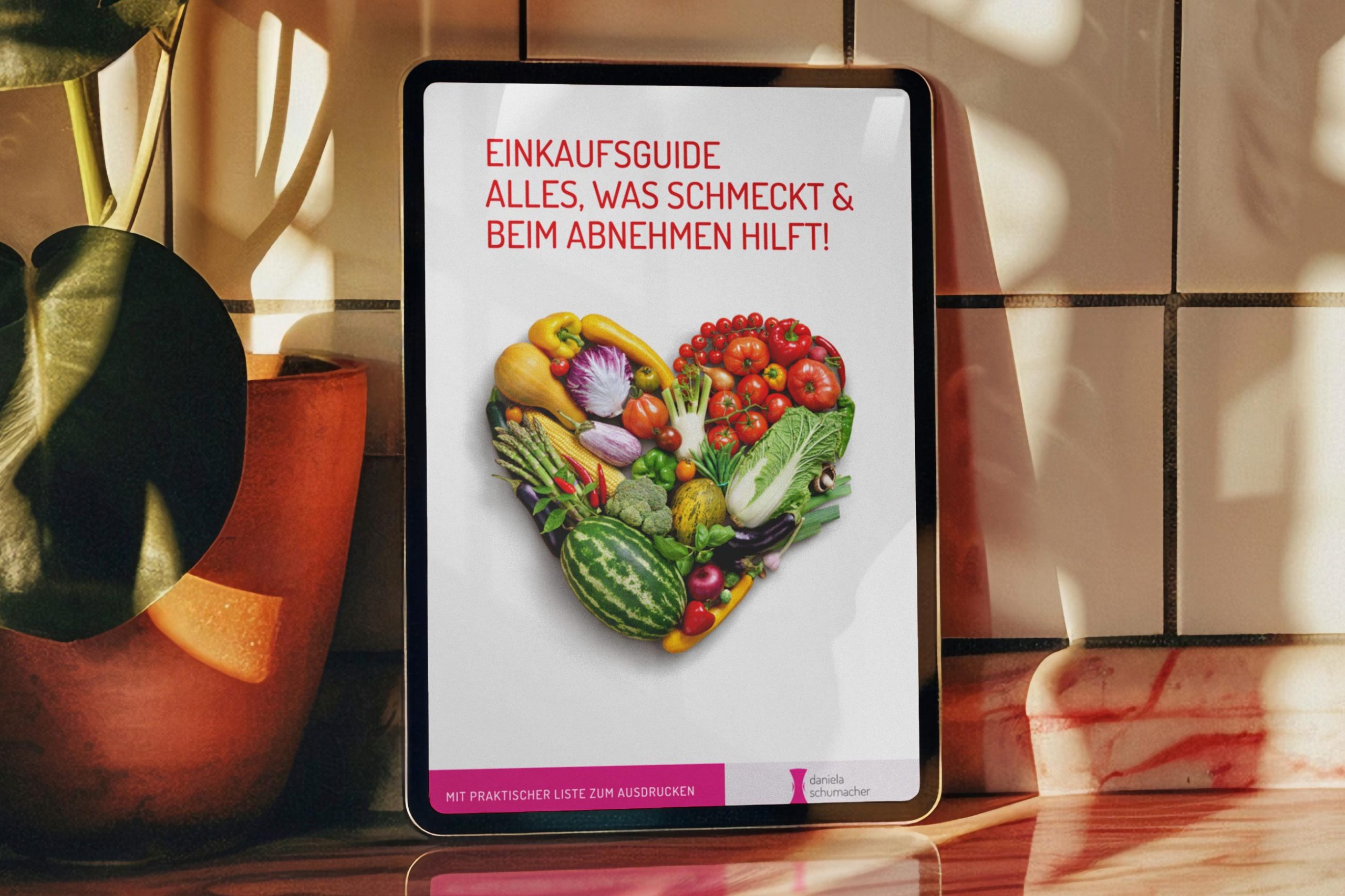
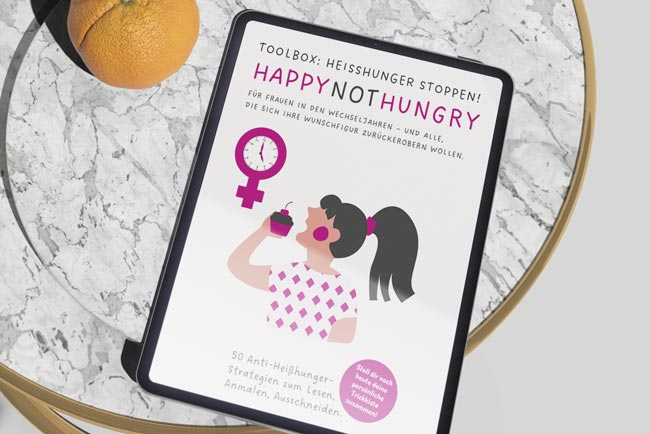
0 Kommentare